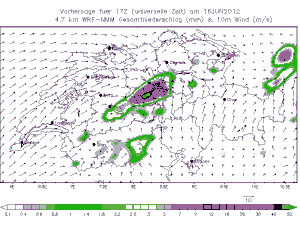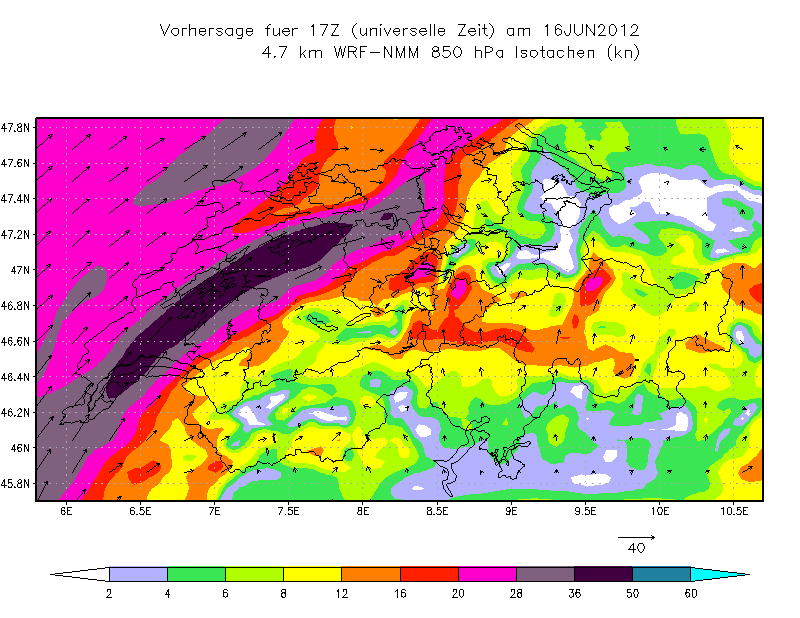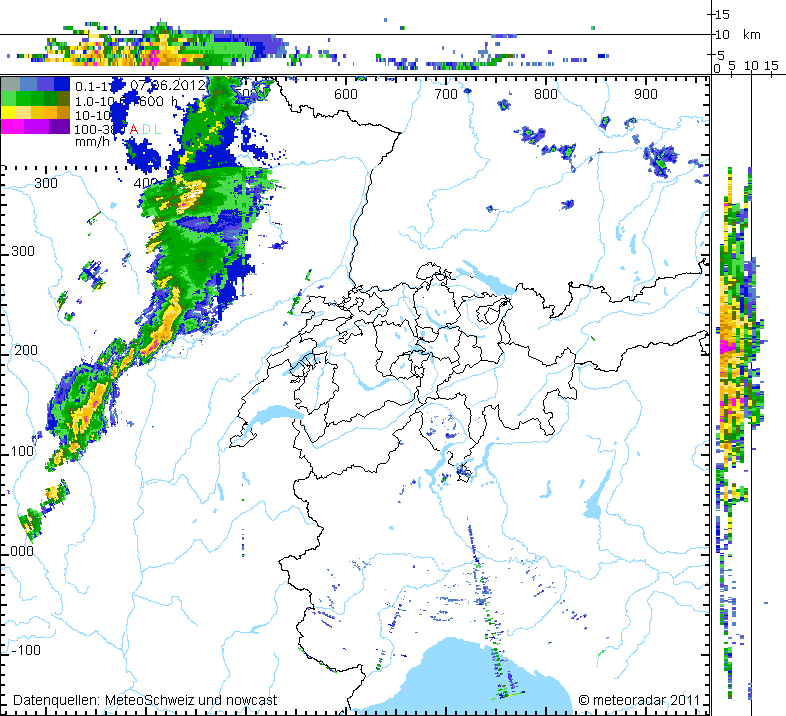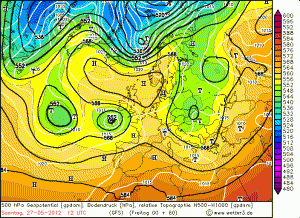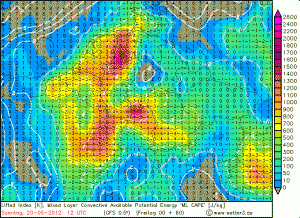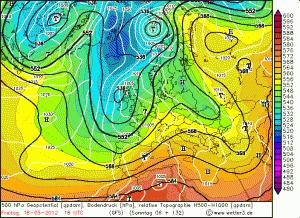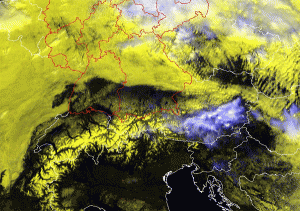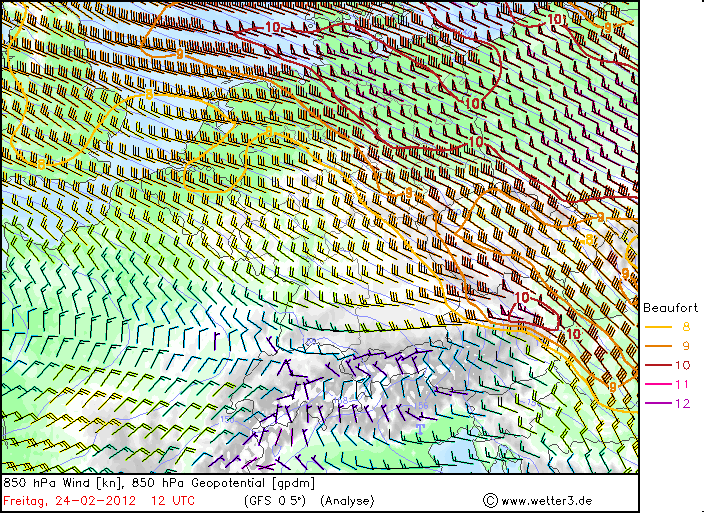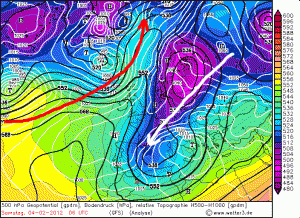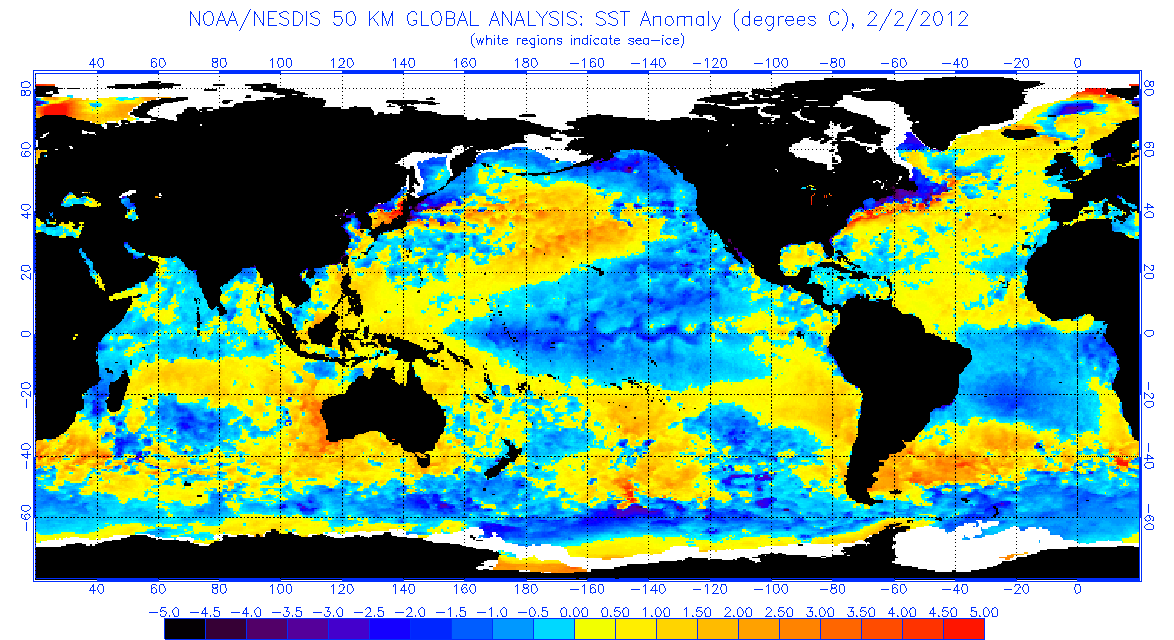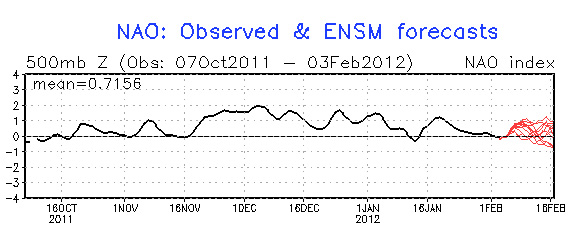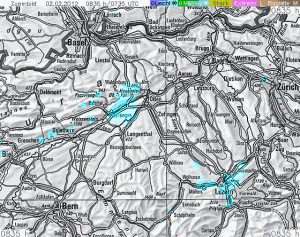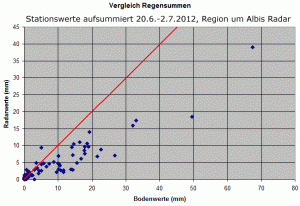
Tagessummenwerte Niederschlag für 8 Stationen im Bereich des Albis-Radars und die Periode 20.6.-3.7.2012
Seit der Aufschaltung des neuen Albis-Radars am 19.6.2012 durch die MeteoSchweiz wurde mehrfach gerügt, dass die Radaranzeige den gefallenen Niederschlag unterschätzt. Nach zwei Wochen Radarbetrieb bei häufigen, zum Teil auch gewittrigen Niederschlägen mit Hagel sind wir in der Lage, eine erste Bilanz zu ziehen. Wir haben hierzu einen Vergleich der Radarwerte mit den Werten an Bodenstationen der MeteoSchweiz durchgeführt. Die Resultate bestätigen den Trend zur Unterschätzung des Niederschlages durch die Anzeige des Albis-Radars, und zwar im Mittel um etwa 50 Prozent. Um diese Aussage zu untermauern, fällt dieser Blogartikel etwas länger aus als sonst üblich. Wir möchten zusätzlich zu den Resultaten unserer Analyse auch einige Probleme aufzeigen, mit welchen wir uns als Kunde eines Monopol-Anbieters von Radarprodukten herumschlagen müssen.
Die MeteoSchweiz liefert uns Radarbilder im sog. gif-Format. Das heisst, dass die Radar-Intensitäten als Binärwerte auf einer Skala von 0-255 verfügbar sind, dies mit einer Pixelauflösung 1×1 km. Zusätzlich hat uns die MeteoSchweiz eine Tabelle geliefert, mit welcher jeder Binärwert in einen Wert der Niederschlagsintensität (mm/Stunde) konvertiert werden kann.
Bei der Auswahl der Bodenstationen für unsere Vergleiche haben wir uns mit Absicht eingeschränkt. Wir haben nur Bodenstationen in der Nähe eines Radarstandortes ausgewählt, welche vom Radar gut sichtbar sind (ohne Berge dazwischen), und welche in grosser Distanz zu den anderen beiden Radars liegen. So können wir sicher sein, dass jeweils nur ein Radar den Niederschlag über einer Bodenstation erfasst. Auf diese Weise können wir auch für jede der drei Radarstationen (Albis, La Dôle und Monte Lema) eine getrennte Analyse durchführen. Dadurch fallen alle Stationen im Bereich um Bern (Mitte zwischen Albis und La Dôle) und im Hochgebirge weg. Für den Radar Albis bleiben 8 Regenstationen übrig, bei La Dole sind es 5 und beim Monte Lema 4 Bodenstationen.
Wir haben für die Periode 20.6. – 3.7.2012 die Tagessummen des Niederschlages (Boden und Radar) berechnet, für alle Tage zusammengezählt und am Schluss durch einfache Division berechnet, wieviel Prozent des Bodenniederschlages durch die 3 Radars angezeigt wurde. Genau ein extremer Tagessummenwert einer Station wurde eliminiert, da der Wert durch Hagel massiv verfälscht wurde. Anbei die Resultate:
– Der Albis-Radar sieht 51% des Bodenniederschlages
– Der Radar La Dôle sieht 85% des Bodenniederschlages
– Der Radar Monte Lema sieht 134% des Bodenniederschlages
Zusätzlich haben wir die Korrelationen der Tagessummenwerte zwischen Boden und Radar für die drei Radarstationen getrennt berechnet. Diese liegen zwischen 0.8 und 0.94. Das sind für Radar-Boden Vergleiche des Niederschlages sehr gute Werte. Die hohen Korrelationen weisen darauf hin, dass die Faktor-Unterschiede zwischen den 3 Radars systematisch sind und nicht mehr nur durch Zufallseffekte erklärt werden können. Zur wissenschaftlich korrekten Untermauerung dieser Aussage wäre allerdings ein „harter“ statistischer Test nötig.
Die beigefügte Grafik zeigt die Tagessummenwerte des Niederschlages im Bereich des Albis-Radars. Perfekte Vergleichswerte wären im Bereich der roten 1:1 Linie zu erwarten. Die meisten Messpunkte liegen unterhalb der roten Linie. Das belegt zusätzlich, dass die gefundene Unterschätzung des Niederschlages durch den Albis-Radar nicht einfach durch 1 oder 2 Ausreisserwerte erklärt werden kann.
Zum Schluss ein Kommentar zu den von der der MeteoSchweiz gelieferten Radarbildern. Diese Bilder sind das Resultat einer hochkomplexen Verarbeitung der Radarmessdaten, welche für den Anwender als riesengrosse „Black Box“ daherkommt. Die MeteoSchweiz hütet diese Black Box wie einen Goldschatz. Kein Mensch ausser den Spezialisten der MeteoSchweiz hat eine Chance, die vielen Schrauben nachzudrehen, die an der Herstellung des Produktes beteiligt sind. Der Kunde ist dem Anspruch der MeteoSchweiz ausgeliefert, den Niederschlag in der Schweiz mit Radar bestmöglich zu erfassen, Sommer und Winter, im Flachland und im Gebirge, bei Regen, Schneefall und Hagel. Dieser Anspruch in Ehren, aber was macht der Kunde, wenn er einen Faktorfehler von 100% feststellt, oder wenn die Hagelschläge vom 1. Juli frühmorgens einfach nicht zur mickrigen Radarfarbe passen, die ein mässig bis starkes Gewitterregeli vorgauckelt?
Als Kunde hätte ich einen kitzekleinen Wunsch, wenn (vielleicht) in 1-2 Jahren die MeteoSchweiz-Daten gratis bezogen werden können: die Rohdaten der Radarreflektivität, Dopplergeschwindigkeit und Polarisation (nicht die modifizierte Regenintensität), Volumendaten, 1 km Auflösung gratis zu beziehen. Dann kann ich nämlich die Korrekturen selbst machen und zwar so, dass sie für meine Kunden passen. Jetzt sind die Rohaten für Privatkunden unbezahlbar. Wieweit sind eigentlich Schweizer Universitäten an der Radarforschung beteiligt? Im Ernst: mehr Offenheit und Konkurrenz im Bereich der Radarforschung und der „Black Box“ würde auch der MeteoSchweiz guttun.